Das Zeitalter der Dummheit
von Tim Caspar Boehme
Müssen wir uns nachträglich vorwerfen lassen, einfach weitergemacht zu haben wie bisher, obwohl wir längst wussten, was da auf uns zukommt?
Um ihre Zeitgenossen aus der Klimalethargie zu reißen, entschied sich die britische Dokumentarfilmerin Fanny Armstrong für einen Rückblick aus dem Jahr 2055. In ihrem Film „The Age of Stupid" (Das Zeitalter der Dummheit) sitzt ein Überlebender der Klimakatastrophe in einem Bunker und klickt sich durch ein globales Nachrichtenarchiv. Anhand von Nachrichten und Dokumentaraufnahmen aus unserer Zeit versucht er zu rekonstruieren, was damals - also heute - eigentlich schief gelaufen ist. Bei seinem Blick zurück in die Zeit vor dem Unglück muss er sich die bittere Frage stellen: „Warum haben wir uns nicht gerettet, als wir noch die Gelegenheit dazu hatten? Sollten wir etwa unsicher gewesen sein, ob wir unsere Rettung auch wert sind?"
Ist Ithaka bei allem Eklektizismus nun auch noch unter die Filmkritiker gegangen? Was hat Ökologieforschung mit Kinofilmen zu tun?
Ökologie beschäftigt sich mit den 2 Milliarden Mikroorganismen, die in einem Gramm Muttererde leben, mit der aromatischen Vielfalt von Nektarblüten, mit der Schädlingsregulierung durch Wespen im Maisbau, mit CO2-Senken durch Biokohle und ebenso mit dem Menschen, der aus lauter Gewohnheit jeden Tag 12mal mehr Abfall produziert, als er an Nahrung, Kleidung und Kultur effektiv benötigt. Ökologie beschäftigt sich nicht nur damit, wie die Natur funktioniert, wenn der Mensch abwesend wäre, sondern betrachtet den Menschen als Teil des Ökosystems, dessen gefährlichster und destabilisierendster Faktor er ist. Ökologie ohne Soziologie und ohne Kunst, mag biologisch, agronomisch, landschaftsgestalterisch wertvoll sein, das Ökosystem, in dem wir leben, wird es nicht retten.
Der Film von Fanny Armstrong ist daher in vielerlei Hinsicht für uns interessant. Zum einen trägt er durch künstlerische Mittel dazu bei, dass wir uns unserer Lage zunächst selbst bewusst werden. Und zum anderen zeigt er allein schon durch seine Entstehungsgeschichte, wie die Gemeinschaft trotz all ihrer festgefahrenen Gewohnheiten eben doch wandlungsfähig ist und ein Engagement zu entwickeln vermag, das weit über jede bloße politische Berechung des Künftigen hinaus reicht.
Wie die ökologische Nutzung der Ressourcen aussehen müsste und wirtschaftlich zugleich tragbar wäre, ist – trotz allen verbleibenden Forschungsbedarfs – längst klar, es müsste nur umgesetzt werden, doch gerade daran scheitert die Gesellschaft. Damit es wider allen begründeten Skeptizismus dennoch gelingt, braucht es den Funken, dank dessen die Gemeinschaft ihre natürliche Angst und Trägheit überwindet und den Elan entwickelt, der den eigenen Schatten lächelnd überspringt. Diesen Funken jedoch kann kein Wissenschaftler und kein Politiker zünden, sondern höchstens ein Künstler, der kein Propagandaziel vor Augen, sondern die Unberechenbarkeit des Schicksals und Daseins erkundet. So wie die Kunst und Literatur vor vier Jahrtausenden in Babylon die Ausgeliefertheit an die verantwortungslosen Götter überwand, so braucht es heute die Kunst zur Rettung des Planeten vor uns selbst. (hps)
Gegen diese Unsicherheit, die man keinesfalls als poetische Rhetorik abtun, sondern in ihrer selbstzerstörerischen Skepsis durchaus ernst nehmen sollte, möchte Armstrong mit ihrem Film nicht nur ein Zeichen setzen, sondern zum Handeln aufrütteln. Anders als etwa Al Gore mit seinem Klimapamphlet „Eine unbequeme Wahrheit" hat sie einen fiktionalen Rahmen gewählt, in den sie ihre eigenen Dokumentaraufnahmen einarbeitet und diese mit kommentierenden Zeichentricksequenzen zu Themen wie Konsumverhalten, Ölindustrie oder globaler Ungleichheit ergänzt.
„Was kann die Welt ändern, wenn nicht ein Film?", sagt Armstrong und zeigt mit ihrem Werk, welche Bedeutung der Kunst selbst im „Zeitalter der Dummheit" noch zukommen kann. Armstrongs Hoffnung, dass ihr Film etwas bewirken wird, könnte tatsächlich aufgehen: Zuschauer der ersten Vorabvorführungen in London äußerten sich überaus bewegt: „Der Film soll nicht glücklich machen, sondern bringt einen dazu, sich zu fragen: Was ist meine Aufgabe?", so ein ergriffener Zuschauer.
Wenn der Film am 15. März seine britische Premiere erlebt, wird er mit Satellitentechnik in 65 Kinos gleichzeitig gezeigt werden. Diese Rekordpremiere soll hervorheben, dass „The Age of Stupid" ein Film ist, der alle angeht. Seine optimistische Botschaft lautet im Kern, dass eine alternative Lebensweise möglich ist und eine Lösung der gegenwärtigen Probleme nur eine gemeinsame sein kann.
Ebenso beeindruckend wie der Film ist auch die Geschichte seiner Entstehung, die nicht nur auf dem starken persönlichen Engagement der Autorin, sondern auch auf der uneigennützigen Unterstützung tausender Briten beruht, die den Film durch Spenden finanzierten. Armstrong, die sich selbst als Amateurin betrachtet und zuvor lediglich drei andere Dokumentarfilme gedreht hat - darunter „McLibel" über den siebenjährigen Prozess von McDonald's gegen zwei mittellose Aktivisten - beschreibt die Entstehung von „The Age of Stupid" daher selbst als Work-in-Progress. Nicht nur der Film an sich, sondern bereits die Geschichte seiner Entstehung könnte sich im Nachhinein als ein erster kleiner Schritt zu einem gemeinschaftlichen Engagement für die Bewehrung der Zukunft erweisen.
Ganz zu Anfang stand jedoch die Idee eines Films über verschiedene Menschen in verschiedenen Weltregionen, deren Leben in irgendeinem mehr oder weniger direkten Zusammenhang mit der gegenwärtigen Klimaentwickung stehen. Da ist die junge Frau aus Nigeria, die für ihr Medizinstudium sparen will und feststellt, dass sie mit Ölschmuggel viel mehr Geld als mit ehrlicher Arbeit zusammen bekommt. Oder der indische Großunternehmer, der die erste Billigfluglinie seines Landes gegründet hat. Ein britischer Windfarmer ist im Kampf gegen lokale Behörden zu sehen. Auch ein amerikanischer Paläontologe wird vorgestellt, der früher für Shell arbeitete und im Wirbelsturm Katrina seine gesamte Habe verlor. Eine der charismatischsten Figuren ist ein steinalter Bergführer in den französischen Alpen, der seine Touren über die schmelzenden Gletscher trotz der schwindenden Schönheit der Gebirgslandschaft unbeirrt fortsetzt.
The Age of Stupid: final trailer Feb 2009 from Age of Stupid on Vimeo.
Die einzelnen Figuren sind auf verschiedene Kontinente verstreut und stehen in keiner direkten Verbindung zueinander, doch teilen sie dasselbe Schicksal - ein Schicksal, das sie hätten abwenden können, so die indirekte Botschaft, wenn sie gemeinsam gehandelt hätten. Im Film stellen sie keine Gemeinschaft her, doch kann man sie in ihrer Abhängigkeit von der Klimaentwicklung als potentielle Klimagemeinschaft sehen, die ihre Chance nicht ergriffen hat. Genau diese Gemeinschaft möchte Armstrong mit ihrem Film herstellen helfen.
Dass ihr Begriff von Gemeinschaft dabei keinesfalls abstrakt ist, zeigt das bereits erwähnte Finanzierungsmodell des Films. Statt sich bei Banken um Kredite zu bemühen, wählten Armstrong und ihre Mitarbeiter die Strategie des „Crowd-Fundings". So wurden die ersten 50.000 britischen Pfund an einem Abend in einem Londoner Pub gesammelt. Von einigen wohlhabenden Einzelpersonen abgesehen, besteht die Mehrheit der Investoren aus Gruppen wie einem Hockey-Team oder einer Muttergruppe. Wenn der Film mehr als eine Million Pfund einspielen sollte, erhalten die Investoren ihr Geld zurück.
Auch für den Verleih wählten Armstrong und ihre Mitarbeiter eine neue Lösung. Statt die Rechte an den Verleih abzugeben und ihm damit die Entscheidung zu überlassen, welche Veranstalter Kopien erhalten können oder nicht, blieben alle Rechte bei den Filmmachern, so dass sie den Film an Gruppen ihrer Wahl verleihen können. Auch kleine Veranstalter wie Kirchen oder Schulen bekommen so die Möglichkeit, den Film zu günstigen Konditionen vorzuführen.
Als wäre all das noch nicht genug, war Armstrong auch beim Bilanzieren der Klimafolgen ihrer Arbeit mehr als gewissenhaft: Sie führte Buch über jede Reise, die für den Film unternommen wurde, und wertete alle Rechnungen für die Produktion nach ihrem CO2-Aufkommen aus. Die Klimabilanz ist im Nachspann zu sehen. Auf die Premiere in deutschsprachigen Kinos darf man gespannt sein.
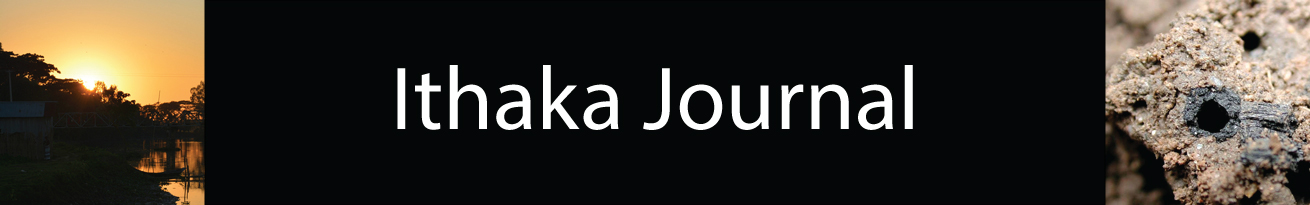
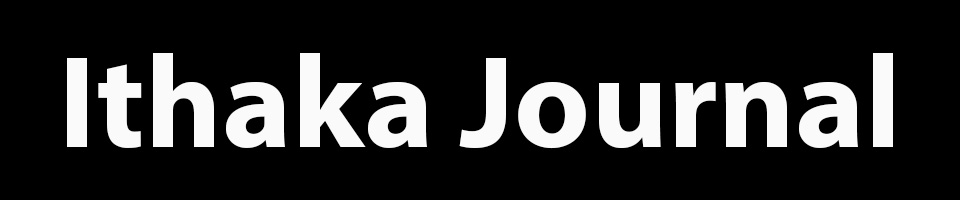
Paul Saladin
08.03.2009 11:54
Die tägliche Beschimpfung der Kreatur Mensch hat ein erträgliches Mass längst überschritten. Es scheint, dass wir babylonischen Zeiten entgegen gehen! Dass es Zeiten gab, wo der CO2 Ausstoss viel höher war als heute, scheint niemanden zu interessieren. Wie entstanden wohl die riesigen Mengen von C-Wasserstoffen in Form von Oelen und Gasen? Um diese sollten wir allerdings Sorge tragen! Irgendwann werden sie ausgehen!
James Lovelock und Gaia Vince, die durch ihre Arbeiten immerhin bewirkt haben, dass die FCKW's verboten wurden, sagen, dass die "Natur" jährlich 550 Gigatonnen CO2 produziert, es ist der Treibstoff der Pflanzenwelt! Der Anteil des vom Menschen produzierten CO2 betrage "nur" 30 Gigatonnen! das sind 5%!! Würde man ihn um die Hälfte reduzieren würde er noch 2.5% betragen!!! Wovon reden wir eigentlich?
Michaela Wetzel
08.03.2009 14:29
Wenn man vieles, was den Machthabern zur Unterdrückung und Erpressung der Menschen, gerade so in den Kram paßt, möglichst oft wiederholt, scheint es zur Wahrheit zu werden. Dass viele anerkannte Wissenschaftler die menschgemachte Klimaerwärmung schon lange bezweifeln und auch Gegenbeweise zu Hauf existieren und die Modelle selbst von den sogenannten Klimaskeptikern, aber mittlerweile auch von langjährigen Klimakatastrophenbefürwortern schon lange als völlig unzureichend und ganz klar falsch bezeichnet, verhallt ungehört. Früher hat die Kirche die Daumenschrauben angezogen, heute ist es die kommende Eiszeit (70 Jahre), das Waldsterben und jetzt die Erwärmung. Es ist ein probates Mittel, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und ein schlechtes Gewissen zu verbreiten. Viel sinnvoller wäre es, Energie zu sparen. Das ist das größte Potential. Und endlich weniger Kinder in die Welt zu setzen, denn diese Überbevölkerung führt letztendlich dazu, dass übermäßig verbraucht wird. Und damit meine ich nicht nur Inder, Chinesen und Afrikaner, auch wir haben definitiv zuviele Menschen in Europa. Wer sind wir, dass wir hier alles zerstören können und allen anderen Lebewesen ihren Lebensraum streitig machen. Wie sagte schon Einstein (aus dem Kopf zititert): "das Universum und die Dummheit der Menschen ist unendlich", wobei ich mir beim Universum nicht ganz sicher bin. Selber denken wäre angesagt und nicht, kritiklos alle Horrorszenarien übernehmen.
Heiko Buresch
08.03.2009 15:43
Jeder kann sofort seinen Beitrag zur Reduzierung des Klimawandels tun, für meine und Ihre Generation kommt dieses böse Erwachen bereits zu spät, ab Ihre Kinder und Kindeskinder usw. die werden Ihnen diese Gute Tat jedoch nie vergessen.
Mein persönlicher Beitrag welchen ich hier von Germany leisten kann, ist für die Entmüllung der Grünen Lunge (Wälder usw.) zu sorgen. Und ich bin längst kein Einzelkämpfer mehr, welcher ehrenamtlich mit anpackt.
Reden war gestern, aber anpacken bedarf es Heute !
rené Bosshard
08.03.2009 17:55
Gratulation Michaela Wetzel, viel bleibt dem nicht hinzuzufügen. Unsere Energieverschwendung scheint doch nicht das Zünglein an der Waage zu spielen, wie es uns die Klimahisteriker weismachen wollen (5%!) Was hingegen ins Gewicht fällt, ist der Umgang mit dem Thema Überbevölkerung; wer das anschneidet, greift in ein Wespennest: Diejenigen, die da etwas über den Tag und die eigene AHV hinaus denken, sind ja keine Kinderfresser. Sogar die Kaninchen, mit denen wir offensichtlich den Drang zur Vermehrung teilen, greifen regulierend ein, wenn sie spüren, dass die Ressourcen knapp sind (selbst gesehen, sehr fremd, wenn eine Zibbe ein paar ihrer Jungen frisst, zugunsten der anderen). Wir, «die Krone der Schöpfung», bedienen uns einfach dann und wann wieder mal des Krieges.
Wirklich zu schützen wären die letzten Regenwälder und zwar schnell, jetzt. Da entstehen die Wüsten ganz ohne Klimaerwärmung, allein durch Gier und Dummheit. Hier vor allem wäre das Prinzip der terra preta nützlich, um die Brandrodungen der Kleinbauern zu begrenzen. Stammt ja auch aus dem Amazonas. Und eben weniger Menschen. Das müsste jetzt angepackt werden – in Eigenverantwortung, bevor es die Natur selbst regelt. Um bei den Kaninchen zu bleiben: Die Kaninchen wären in Australien von selbst verschwunden, genau dann, wenn alles kahlgefressen gewesen wäre. Nun daran arbeiten wir noch: Am Kahlfressen. Eben: seid furchtbar (sic) und vermehret euch.
Christoph Obrecht
08.03.2009 20:31
Einige der obigen Beiträge zu diesem Thema (Saladin, Wetzel und Bosshard) sind beschämend. Ich kenne deren Ausbildungen nicht und ich weiss auch nicht, woher diese Personen ihr Wissen über gewisse Klima-Zusammenhänge nehmen.
Es scheint mir wichtig, dass Leute, die behaupten, die Geschichte mit der Klimaerwärmung bzw. mit einem Zusammenhang mit antropogenen Einflüssen auf unser Klima seinen erfunden, die nötigen Grundlagen noch einmal studieren.
Einfach gesagt, geht es ja darum, dass der Mensch dabei ist, ein Gleichgewicht zu stören, das sich in den ca. 650'000 vergangenen Jahren nicht entscheidend verändert hat. Die behaupteten Mengen jährlichen natürlichen CO2 Ausstosses von vielleicht 550 GT gegenüber einer verschwindenden Menge von 30 GT durch den Menschen verursachte Menge CO2 sind natürlich à la Blick dargelegt, ohne zu erwähnen, dass ebenso im Umfang von wiederum 550GT CO2 in Biomasse gebunden oder via Sedimentation wieder aus dem Kreislauf entnommen werden.
Die verbleibenden 30GT (bitte streiten wir nicht um Tonnen) entstammen einzig aus der Verbrennung von fossilen Lagern.
Ich möchte darum bitten, auf weitere haltlose und ermüdende Beiträge zu verzichten. Ansonsten rate ich obigen Rednern, vom Genuss "biologischer" Weinen abzusehen - unter diesen Umständen reicht auch ein einfacher Roter aus dem Denner.
Werner Kuhnle
08.03.2009 21:36
Zum Film:
Wenn der Film das hält, was in dem Beitrag von H. Boehme angekündigt ist,
dann bin ich sehr gespannt darauf und werde ich ihn ansehen, sobald ich eine Möglichkeit dazu habe.
Zu den vorangehenden Kommentaren:
In einigen der vorangehenden Kommentaren wird m.E. das Kind mit dem Bad ausgeschüttet:
Auch Lovelock, der im ersten Kommentar bemüht wird, geht davon aus, daß die Klimaerwärmung real ist, ja er meint sogar, daß maximal 1 Milliarde Menschen sie überleben können !
siehe http://www.ithaka-journal.net/letzte-chance-fuer-die-menschheit
Richtig ist, daß Vorhersagen über längere Zeiträume nie exakt sein können; diesen Anspruch erheben seriöse Prognosen aber auch nicht.
"Dass viele anerkannte Wissenschaftler die menschgemachte Klimaerwärmung schon lange bezweifeln und auch Gegenbeweise zu Hauf existieren" kann ich nicht sehen (Wer soll das sein ? Wo sind die Gegenbeweise ?).
Im Gegenteil scheint es eher so zu sein, daß die Prognosen (zB. die des IPCC) viel zu konservativ/vorsichtig waren und die Realität diese schon überholt hat (zB. bezüglich Prognosen über Geschwindigkeit beim Rückgang des arktischen Eises).
Michael Bauch
09.03.2009 14:54
Zuerst: auf den Film bin ich sehr gespannt.
Zu einigen Kommentaren: Ich weiß nicht woher die Schreiber die vielen Wissenschaftler nehmen, die meinen, daß der Mensch nichts zur Klimaveränderung beiträgt. Gewiß gibt es davon einige Wenige und widersprüchliche Auffassungen der Wissenschaft können nur weiterhelfen, aber diese als einzige fundierte Lehrmeinung darzustellen ist schon drastisch. Das sich Tatsachen erst durchsetzen müssen,ist ja schon mindestens seit Kopernikus bekannt.
Den Menschen dann mit Kaninchen zu vergleichen ist dann allerdings schon das Letzte.So ähnlich wurden im vergangenen Jahrhundert von gewissen Philosophen Kriege und Hungersnöte als Notwendigkeit für die Menschheit begründet. Jeder Mensch hat ein Recht auf sein Leben und die Erde kann auch alle Vernünftig ernähren, wenn der Mensch nicht seinen eigenen Lebensraum durch Ausbeutung,ungezügelte Profitgier und Krieg zu zerstört.
Michaela Wetzel
10.03.2009 17:37
Nachtrag, (danke, Herr Bosshard, das ist so ein Thema, bei dem man nicht sehr oft auf Zustimmung trifft)
Ich rate den geschätzten Mitschreibern, sich auch mal unter der Rubrik "Klimaskeptiker" zu informieren und nicht nur den gängigen Medien Glauben zu schenken. Natürlich wäre das den Puppenspielern am allerliebsten, wenn jeder unbesehen das glaube würde, was sie so in die Welt setzen. Wenn das mit dem bösen CO2 so stimmt, wie die Klimakatastophenstimmen singen, müßten wir die wunderschönen Weinberge gleich wieder vergiften, denn da hausen eindeutig viel zu viele kleine Krabbeltiere, die unglaublich viel pupsen und dadurch ganz klar somit auch zur Klimaerwärmung beitragen, wie Schafe und Rinder. Dann sollten alle, die sich vor der menschgemachten Klimaerwärmung fürchten, gleich mal aufhören, Fleisch zu essen (was ich schon seit 25 Jahren nicht mehr tue, aber jedem das seine). Das wäre mal ein Beitrag. Und was die Kaninchen angeht, die richten bedeutend weniger Schaden an als wir. Auch wenn leider die Ansicht, dass alle Lebewesen auf dieser einen Erde eine Daseinsberechtigung haben, von den wenigsten akzeptiert wird.
Ein bisschen weniger Gier, ein wenig mehr Achtung vor der "Schöpfung" wäre angebracht. Wir kämen (fast) alle mit bedeutend weniger Energieverschwendung (15. Paar Schuhe, 20 T-Shirt, 2 Autos, 3 Fernseher etc. pp.) aus, aber die Welt scheint im Kaufrausch.
Im übrigen bin ich der Meinung, man sollte höflich bleiben und auch andere Meinungen (die ja in der Tat nicht die Wahrheit darstellen müssen) akzeptieren. Nicht wahr, Herr Obrecht? Es geht auch ohne Beleidigungen. Ich sehe nirgendwo geschrieben, dass man gezwungen wäre, die am weitesten verbreitete Meinung anzunehmen, auch wenn das bequem wäre.
Stefan E. Stöckli
10.03.2009 22:15
Warum hacken plötzlich alle auf mir rum? Seit Jahrtausenden bin ich da und stelle einen wichtigen Teil der Lebenskette dar. Ohne mich gäbe es doch gar kein Leben! Das Pflanzenreich braucht mich doch so sehr. Nicht nur die Bäume, sondern auch die Reben. Denn ohne mich würden sie verenden, elendiglich ersticken und könnten keine Trauben hervorbringen, die dann durch meinen Bruder Sauerstoff zu Wein vergären. Wein, den die Menschen so sehr lieben. Und nun diese Panik vor mir. Von einem Tag auf den anderen lassen sich die Menschen einreden, ich sei gefährlich für sie. Dabei bin ich doch ein Teil von Ihnen und Ihrem Lebenszyklus.
In ihrem Wahn, nur noch die Details im Detail zu sehen, haben Sie mich aus dem Lebenskreis harausgerissen und stellen mich an den Pranger. Sie klagen mich an, für ihren Klimawandel verantwortlich zu sein. Sie fürchten sich vor Wärmeperioden, die es schon immer gab und immer wieder geben wird. Sie vergessen dabei, dass es Ihnen in Wärmeperioden immer gut gegangen ist, dass sie in Kälteperioden aber Hunger litten und mit Seuchen und Krankheiten zu kämpfen hatten.
Nun haben die Menschen über mich gerichtet und mich für schuldig befunden. Denn sie lieben die Bequemlichkeit: mit einem Schuldigen ist bewiesen, dass alle anderen Anwesenden ja unschuldig sind und keine Verantwortung tragen... Mich lässt das eigentlich kalt, denn mir kann man nichts anhaben: ich war schon immer da und werde immer da sein.
Doch mir tun die Menschen leid. In ihrer Kurzsichtig sehen sie nicht, dass sie ihr Verhalten überdenken müssten. Unter anderem wollen sie nicht zur Kenntnis nehmen, dass sie ihren Lebensraum zu einem Mikrowellenofen verkommen lassen haben. Mit Strahlen von Satelliten, Radaranlagen, Atomkraftwerken und ihrem Abfall, Forschungszentren mit ihren unheimlichen Versuchen, Fernseh-, Radio-, Funk- und Telefonstrahlen und nicht zuletzt mit der Verwendung von uran-angereichter Kriegsmunition haben sie für eine erhöhte Dynamik im Energiefeld der Erde gesorgt. Eine weitaus grössere Gefahr für die Lebensgrundlagen der Menschen, als ich es jemals sein könnte. Aber ich habe halt keine Lobby ... ich brauche auch keine, denn, wie gesagt: ich war schon immer da und werde immer da sein. Ohne mich, das CO2, steht der Lebenskreislauf still !
Werner Kuhnle
15.03.2009 16:57
Tut mir leid, liebe "Klima-Skeptiker",
aber es gibt wenig wissenschaftliche Theorien/Thesen, die ähnlich gut und breit erforscht und überprüft sind wie der Klimawandel.
Die Lobby der Interessen-Gruppen, die den Klimawandel (idR. aus wirtschaftlichen Interessen heraus) früher bestritten haben (was sie wegen der inzwischen erreichten Beweislage nicht mehr gut können) und jetzt noch versuchen, trotzdem so weiterzumachen wie bisher (siehe zB. Bau neuer Kohle-Kraftwerke) ist doch seit Jahrzehnten viel stärker als die Lobby der Interessen-Gruppen, die vom Klima-Wandel profitieren !
Befasst Euch doch einfach mal mit den Fakten !
Ihr braucht nur ein bischen zu googeln und schon habt Ihr jede Menge Material; ein Link als Bsp:
http://www.pik-potsdam.de/~stefan/klimaskeptiker.html
Was den vorigen Beitrag mit dem "armen" CO2 angeht:
Das ist halt ein bischen wie in der Medizin : Die "richtige" Dosis macht es ! Wenn die Dosis zu hoch ist, dann kann ein eigentlich nötiger, völlig harmloser und ungiftiger Stoff trotzdem schlimme Folgen haben ..
Lukas
02.09.2009 10:32
Auch die Automobilbranche scheint ja nachzurüsten und mitlerweile schonendere Autos zu produzieren. Ich fahre lieber Motorrad als Auto, auch weil dieses einfach deutlich weniger Verbraucht als jedes andere Auto.
Michael Habakuck
18.11.2015 13:25
Ich brauche keine Klimazukunftsfilme und noch so gut gemeinte Tipps. Was ich brauche, ist eine weltweite Ächtung der Rodung von Wäldern, insbesondere der Regenwäldern. Was ich noch brauche, sind wirklich verantwortungsvolle Politiker und Techniker, die nicht ständig angeblich umweltfreundliche Projekte, wie Biosprit, Elektroautos, Margarine (Palmöl) etc. propagieren und fördern.