Es ist Frühjahr und keine Pflanzenkohle auf dem Hof
von Hans-Peter Schmidt
Hat sich seitdem herausgestellt, dass Humusaufbau die Landwirtschaft doch nicht krisenfester macht? Oder dass die extremen Wetterereignisse doch nicht häufiger auftreten? Oder dass die Pestizide letztlich weder die Tierwelt noch unsere Gesundheit schädigen, Nitrat dem Grund- und Trinkwasser nichts anhaben kann? Und dass Pflanzenkohle doch nicht hilft, die Nährstoff- und Kohlenstoffkreisläufe in der Landwirtschaft zu schließen?
Pflanzenkohle scheint aus der Landwirtschaft verschwunden
Dabei ist es gar nicht so, dass Pflanzenkohle vom medialen Tablett gestoßen wäre. Ganz im Gegenteil, es finden sich immer wieder Redaktoren und Journalisten, die sich von dem Thema mitreißen lassen. Nur geht es dabei nicht mehr um die Landwirtschaft, sondern hauptsächlich um die Klimawirkung. Auf extrem niedrigem Niveau (300.000 Tonnen CO2e pro Jahr im Vergleich zu jährlichen CO2e-Emissionen von 40,000,000,000 Tonnen weltweit …) ist Pflanzenkohle in den letzten Jahren zur wichtigsten Negativemissionstechnologie geworden, die bereits heute langfristig Kohlenstoff außerhalb der Atmosphäre sicher speichert. Während Bäume, Böden und Moore zwar teilweise angepflanzt bzw. wieder aufgebaut werden, verlieren sie im globalen Maßstab mehr Kohlenstoff als sie aufnehmen. Und die anderen technischen Lösungen wie DAC (direkter CO2-Entzug aus der Atmosphäre) und beschleunigte Gesteinsverwitterung existieren bisher nur in der Testphase bzw. in sehr kleinem Maßstab. In Abwesenheit aller anderen Methoden ist Pflanzenkohle zur Klimatechnologie geworden und bekommt dafür erhebliche Investorengelder. Die Landwirtschaft aber, in der die Pflanzenkohle eigentlich Anwendung finden sollte, schein dabei in Vergessenheit geraten zu sein.
Klimaschutz braucht nicht nur Grossinvestoren
Die neuen Klimaschutzinvestoren rechnen oft ohne diejenigen, die Biochar in ihren Böden zur eigentlichen geologischen Senke machen. Sie bauen darauf, dass Landwirte weltweit die überteuerte Pflanzenkohle kaufen werden, in ihre Böden einarbeiten, sich im Globalen Kohlenstoff Register eintragen lassen und es den Investoren erlauben, ihr Klimageschäft wie eine App im Internet weltweit skalieren. Sie investieren liebend gern in Maschinenbauer, Produktionsanlagen, Handelsplätze und am allerliebsten in Kontrollorgane, sogenannte dMRV-Provider (digitales Monitoring, Registrierung, Verifizierung), aber es wurde noch nie gesehen, dass ein Venture Capitalist (ein Investor, der davon lebt, sein spekulatives Investment schneller und sicherer als an der Börse zu mehren) in die Erforschung und Entwicklung landwirtschaftlicher Anwendung von Pflanzenkohle investiert.
Für die Biochar-Branche ist die industrielle Anwendung im Beton, in Plastik, im Asphalt und in Kohlefaserstoffen ohnehin viel interessanter. Das lässt sich mit wenigen Unterschriften exponentiell skalieren. Da braucht es nur wenige Geschäftspartner (große Unternehmen), die den gleichen Schlipps tragen und die gleiche Sprache sprechen.
Das Verständnis der Biochar-Branche reicht nicht bis zur Farm und nichts wäre ihr lieber, als ganz auf die Komplikationen der Landwirtschaft mit ihren viel zu vielen Einzelvertretern zu verzichten. Wirtschaftlich ist das selbstverständlich nachvollziehbar. Und es wäre auch viel zu einfach, nur die Biochar-Branche anzuklagen, wenn Pflanzenkohle derzeit kaum noch eine Rolle in der Landwirtschaft spielt. Hier ist die Landwirtschaft unabhängig von der Industrie, den Lobbyisten, und der Klimafrage selbst aufgefordert.
Kleinanlagen für Landwirtschaftsbetriebe: Die zweite Demokratisierung der Pflanzenkohle
Natürlich lohnt es sich für niemanden, der Kartoffeln für 170 Euro pro Tonne oder die Tonne Trauben für 410 Euro oder die Tonne Weizen für 210 Euro verkauft, 1000 Euro pro Tonne Pflanzenkohle zu bezahlen. Etwas ganz anderes ist es, wenn auf der Farm eine kleinere Pyrolyseanlage steht, deren Abwärme im Winterhalbjahr das Wohnhaus, Büro, Atelier und die Trocknungsanlage versorgt. Die Anlage wird mit Biomasse-Reststoffen betrieben, die auf der Farm selbst anfallen und für die bisher kaum Nutzen bestand. Sie kostet etwas mehr als ein gewöhnlicher Heizkessel, aber kann ein breiteres Spektrum an Biomassen verwerteten. So kann Pflanzenkohle für geringe Selbstkosten im Stall und der Gülle eingesetzt und organisch beladen mittelfristig die Böden aufbauen und den ganzen Hof resilienter gegen Extremwetterereignisse machen. Ob es dann noch zusätzliche Klimazertifikate braucht oder der Landwirt ohne Zertifikatsbürokratie einfach seine eigenen Emissionen ausgleicht, kann dann immer noch jeder für sich selbst überlegen.
Die Preise für Pflanzenkohle aus industriellen Großanlagen werden wohl auch in Zukunft nicht deutlich sinken, da die Preise für Biomassen eher steigen als fallen. Industrieanlage werden auch in Zukunft an der Landwirtschaft vorbeiproduzieren. Seriengefertigte Kleinanlagen, die Wärme und Pflanzenkohle aus einer Vielfalt landwirtschaftlicher Restprodukte herstellen, ist der einzige Weg, der die Pflanzenkohle in der Landwirtschaft hält und zugleich die Autonomie kleinerer und mittlerer Höfe stärkt.
Pyronet in der Schweiz, Guntamatic in Österreich und Biomacon in Deutschland stellen solche Kleinanlagen bereits her. Mögen andere Hersteller bald hinzukommen. Auch muss nicht jeder allein sein Glück suchen: genossenschaftliche Anlagen von mehreren Höfen könnten ein neuer Weg sein, Pflanzenkohle z.B. aus Ernteresten von Agroforstplantagen herzustellen. Noch fehlen hier Vorbilder und Baukastensysteme, mit denen man solche Modelle einfach aufbauen kann. Auch Kommunen könnten aus kommunalem Grünschnitt sowie aus dem Grass- und Heckschnitt der Gemeindemitglieder Nahwärmenetze versorgen und den Gärtnern und Landwirten der Gemeinde kostengünstig die Pflanzenkohle abgeben.
Und wer im Frühjahr noch Pflanzenkohle für den Garten oder den Hühnerstall braucht, für den gibt es wie immer den Kon-Tiki.
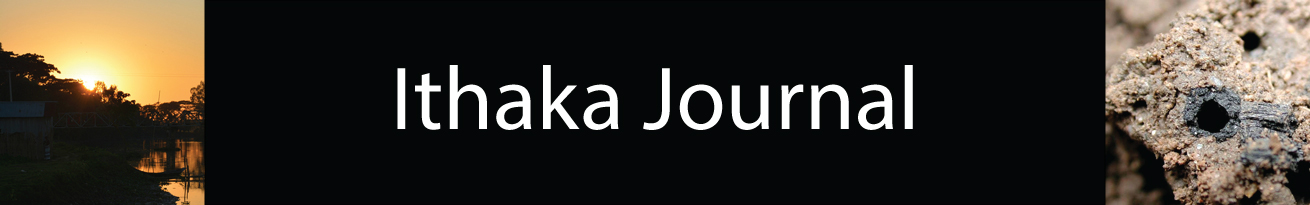
Bitte diskutieren Sie hier im Forum Ihre Gedanken und Kommentare zum Artikel.
Sie können sich hier für unseren Newsletter anmelden.