Naturwein - bloße Mode oder Kunst ?
von Claudio Niggli
Der moderne Weinkeller als Industrie-Labor
Viele Weintrinker sind nach wie vor der Überzeugung, dass jeder Wein ein naturbelassenes Produkt sei. Das Gegenteil ist jedoch der Normalfall. Vieles, was sich Wein nennt, ist im Grunde nur fahrlässig manipulierter Traubensaft. Bei der standardmäßigen Produktion wird das Traubengut noch vor der Gärung durch schweflige Säure sterilisiert. Alle natürlichen Hefen, welche im Weinberg heimisch sind, werden ebenso wie das mikrobielle Weinleben abgetötet. Danach wird industriell produzierte Reinzuchthefe beigegeben - ein Milliardenmarkt für Biotech-Firmen. Nach der alkoholischen Gärung kommen selektionierte Bakterien für den Abbau von Milchsäure zum Einsatz, worauf das weinähnliche Getränk dann abermals mit schwefliger Säure „stabilisiert“ wird.

Ist der Säuregehalt zu hoch, um es mit dem Modeprofil vereinbaren zu können, wird dieser kurzerhand durch Zugabe von Basen gesenkt; und ist der Säuregehalt zu niedrig, wird nachgesäuert. Durch Temperaturregulation während der Gärung lassen sich intensiv fruchtige Primäraromen entwickeln. Umkehrosmose ist bei Übererträgen ein besonders beliebtes physikalisches Mittel, um Flüssigkeiten aufzukonzentrieren, womit der Eindruck eines gehaltvolleren Weins entsteht. Filtration und Schönung entfernen Hefe- und andere Trubpartikel, wodurch der Wein zwar kristallklar wird, aber maßgebliche Aromakomponenten verloren gehen. Vor der Abfüllung wird noch einmal die schweflige Säure aufkonzentriert, was aber die Effizienz konservierender weineigener Antioxidantien massiv vermindert. Durch neue Barriques, oder im schlimmsten Fall Holzchips, erhält der Wein eine mehr oder weniger ausgeprägte Vanille-Zigarrenkistchen-Aromatik aufgesetzt.
Diese im oberen Absatz beschriebenen Standardmethoden gehören allesamt zu den sogenannten sanften Vinifiziertechniken. Das wahre Horrorkabinett öffnet sich erst, wenn man in die Liste der für die konventionelle Weinproduktion zugelassenen Verfahren schaut: (Verzeichnis der zugelassenen önologischen Verfahren und Behandlungen, Deutsches Weingesetz) .
Besonders brisant an dieser Liste ist, dass in der EU die Verwendung von önologischen Hilfsmitteln für Bioweine im Gegensatz zum Traubenanbau bisher nicht standardmäßig geregelt ist. In den meisten Ländern sind also die in der obigen Liste aufgeführten Techniken und Zusätze auch für zertifizierte Bioweine nach wie vor erlaubt. In dieser Hinsicht nimmt Delinat eine Pionierrolle ein, denn in den Delinat-Richtlinien wurden von Beginn an auch die Kellertechniken in die Biozertifizierung einbezogen. In den neuen, 2010 in Kraft getretenen Richtlinien wurden die erlaubten Mittel und Methoden noch einmal deutlich eingeschränkt, um sich der Zielvorgabe gänzlich naturbelassener Weine zu nähern (Delinat Richtlinien 2010). Ab Herbst 2010 werden zudem für jeden Wein sämtliche angewandten Methoden und Mittel auf einer entsprechenden Internetseite öffentlich zugänglich gemacht.
Mit den industriell üblichen Vinifizierungstechniken entstehen jene gestylten, marktwirtschaftlich perfekten Modeweine, welche die breite Masse ansprechen. Es sind unkomplizierte, anonyme, weiche und vermeintlich gehaltvolle Weine, welche mit intensivem Bouquet auftrumpfen. Mit ihrer glatten Gefälligkeit finden sie besten Zuspruch beim unbedarften Käufer, entbehren aber eigenständigen Charakter und lassen jegliche „Ecken und Kanten“ vermissen. Die Jahrgangschwankungen sind infolge der vielen gezielten Eingriffe entsprechend gering.
Der Verbraucher als Gewohnheitsmensch
Es gehört zu den Eigenheiten des Menschen, dass er sich gerne an gewisse Geschmacksrichtungen gewöhnt. Produkte, welche mit reichlich geschmacksverstärkenden Zusätzen versehen sind, verkaufen sich heutzutage besonders gut, denn als produktive Individuen der westlichen Leistungsgesellschaft nimmt man sich kaum mehr die Zeit für gustatorische Finessen – wir stumpfen mehr und mehr ab. Reizüberflutung und Zeitdruck sind Gift für eine intensive, bedächtige und interessierte Auseinandersetzung mit unseren Sinneswahrnehmungen und mit Genussmitteln. So produziert die Lebensmittelindustrie mehr und mehr nichtssagende Fastfood-Qualität, die jeglichen Bezug zum Ursprung der natürlichen Zutaten vermissen lässt. Das macht sich auch in der Weinindustrie bemerkbar.

Schon durch die Wahl ihrer ersten Weine zwingen die nichts ahnenden Jungkunden ihrer Geschmackswelt bereits eine bestimmte Richtung auf. Die nächsten Weine werden bereits nach diesen vorformatierten Geschmacksbildern ausgewählt. Was einmal gefiel, wird immer wieder gekauft. Manche Weintrinker behalten diese Tendenzen fast ein Leben lang bei, und was nicht dem einen gewohnten Profil entspricht, wird für schlecht gehalten. Sichere Werte sind gefragt, eine Umgewöhnung des Geschmacks wird nicht für notwendig gehalten. So erwarten die meisten auch, dass ihre Lieblingsweine jedes Jahr identisch schmecken und dem wird durch die übermäßig gewinnorientierten Weinproduzenten bereitwillig Rechnung getragen.
Wein trinken und mögen lernen
Im Allgemeinen herrscht also der Irrglauben, dass Geschmack etwas Vorbestimmtes, Unabänderliches ist. Aber wer sich für Neues, Ungewohntes öffnen kann, dem ist eben auch die Chance vergönnt, dass sich das Spektrum seiner Vorlieben erweitert, sich der Geschmack verfeinert und ganz neue Horizonte öffnen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters – Wohlgeschmack im Munde des Genießers.
Wir lassen uns viel zu oft vom ersten Eindruck beeinflussen und verurteilen voreilig, was nicht Bekanntem und Gewohntem entspricht. In diesem Zusammenhang wird ein Aspekt gerne vergessen: Jede sensorische und somit auch geschmackliche Wahrnehmung wird beeinflusst durch Faktoren wie Tageszeit, emotionale und psychische Verfassung, physische Konstitution, kulinarische Begleitung und durch die Atmosphäre des Ortes. Wer z.B. gelernt hat, dass gerbstoffreiche, die Schleimhaut trocknende Weine wenigstens durch kleine öl- oder fetthaltige Häppchen begleitet werden sollten, dem eröffnet sich plötzlich eine neue, aufregende Welt. Auch wichtige weinbezogene Parameter wie Trinktemperatur, Sauerstoffzufuhr, Alter, ja sogar die Form des Glases werden oft vernachlässigt. Diese Einflussgrößen sind vor allem für den Genuss von komplexen, qualitativ hochwertigen Weinen wichtig. Je „gemachter“, also je stärker manipuliert ein Wein ist, umso mehr treten diese Faktoren in den Hintergrund.
Viele Weintrinker erwarten von teuren Weinen aus niedrigen Erträgen, dass sie sich alkoholreich, hocharomatisch und schwer präsentieren. Es sollen Typen sein mit sehr viel Extrakt. Für einen Wein mit besonders ausgewogener Struktur, also einem elegant wirkenden Verhältnis von Säure, Gerbstoffen, Alkohol und restlichem Extrakt, würden die wenigsten Normalverbraucher nach einer Blinddegustation einen ähnlich hohen Betrag ausgeben, denn der Preis wird mit Qualität, und Qualität mit Wucht, gleichgesetzt. Auch deshalb haben authentische, etwas schlankere Spitzen-Naturweine (z.B. aus kühleren Lagen) nicht selten einen schweren Stand.
Natürliche Weine als unstete Verwandlungskünstler
Bei der Produktion von natürlichen Weinen aus ökologischem Anbau wird weitestgehend auf oben genannte Manipulationen bei der Weinbereitung verzichtet. Der ganzheitliche, naturnahe Ansatz im Anbau findet seine logische Fortsetzung im Keller. Das Traubengut stammt von nachhaltig bewirtschafteten Weinlagen, und wird nicht durch Dünger und Pflanzenschutzmittel übergewichtig und ungesund. Die Trauben enthalten mehr wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, wie z.B. Tannine, Alkohole, Mineralien und Vitamine. Der Winzer ist bestrebt, das Terroir im natürlich ausgereiften Wein auszudrücken, wodurch der Wein zum Spiegel der Rebsorte, der rebeigenen Hefen und anderer lokaler Gegebenheiten, wie Boden und Klima, wird.

Diese naturnahe Weinbereitung bringt mit sich, dass die schwankenden Einflüsse des Jahreswetters stärker spürbar werden, was im Jahrgangsvergleich zu großen Unterschieden im Weincharakter führen kann. Durch die spontane Vergärung mit reb- und kellereigenen Weinhefen kommt ein bedeutendes Unsicherheitselement in der ganzen Produktionskette hinzu, denn die Hefezusammensetzung im Weinberg und Keller schwankt mit den wechselnden Umweltfaktoren. Der diffizile Prozess der Vergärung ist dem Zusammenspiel der Mikroorganismengemeinschaft und der schwankenden Traubenqualität unterworfen. Diese können, wenn der Kellermeister falsch reagiert, das Aroma eines Naturweins so stark beeinflussen, dass er unwiderruflich verdirbt. Aceton, Acetaldehyd, Essigsäureethylester oder Schwefelwasserstoff sind nur einige Beispiele von unangenehm riechenden flüchtigen Stoffen, die die Existenz eines Naturwinzers gefährden können. Naturweine, die wirklich nur aus Trauben und frischer Luft vinifiziert werden, lassen sich nicht nach Schema und Lehrbuch herstellen, sondern brauchen viel Erfahrungen und Einfühlungsvermögen. Erst im Naturwein zeigt sich letztlich die wirkliche Meisterschaft und Kunst eines Winzers (siehe auch: Weine aus Trauben und frischer Luft, sonst nichts).
Saubere, gut überwachte und sensible Arbeit im Keller muss das Credo jedes Naturwinzers sein, denn nur so kann er das komplizierte Zusammenspiel der über 2000 natürlichen Weininhaltsstoffe optimal lenken. Sonst bezahlt der Naturwinzer unweigerlich den Preis für sein Risiko, wenn seine Weine aufgrund von Fehltönen als ungenießbar eingeschätzt werden. Durch den Verzicht auf Filtration und Schönung verbleiben vermehrt Bestandteile der Hefe und der Trauben im Wein, was die Aromatik ebenfalls entscheidend beeinflusst. Die Zugabe von schwefliger Säure wird auf den Zeitpunkt vor der Abfüllung reduziert, einige erfahrene Naturwinzer verzichten ganz darauf.
All die genannten Faktoren führen dazu, dass eine Voraussage der Weinentwicklung in der Flasche sehr schwierig ist. So lässt sich bei Naturweinen vermehrt feststellen, dass sie nach der Abfüllung Phasen durchlaufen, bei welchen komplexe biochemische und physikalische Prozesse im Spiel sind. So kann sich ein und derselbe Wein in einem Monat unharmonisch zeigen, in einem weiteren mit all seinem Reichtum offenbaren; heute präsentiert er sich fruchtig, morgen stehen vielleicht eher mineralische und holzige Noten im Vordergrund. Manche Weinhändler sind überzeugt, dass auch Wetterwechsel; Mondphasen und Luftdruck eine Rolle spielen, was aus physikalischer Sicht durchaus nachvollziehbar ist.
Während sich in Deutschland erst nach und nach herumspricht, was einen Naturwein von Industrie- und sogar von traditionellen Bioweinen unterscheidet (siehe u.a. Naturweinrally), hat sich in Frankreich, Belgien und der romanischen Schweiz bereits eine ganze Bewegung von Naturwinzern und Naturwein-Degustatoren formiert. Besonders hervorzuheben ist hier die Association des Vins Naturels (AVN), deren weit über 100 Winzer sich zur Einhaltung der Charta für natürliche Vinifizierung verpflichtet haben.
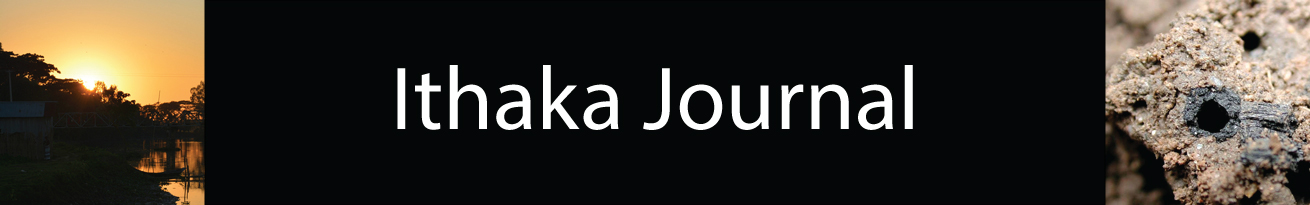
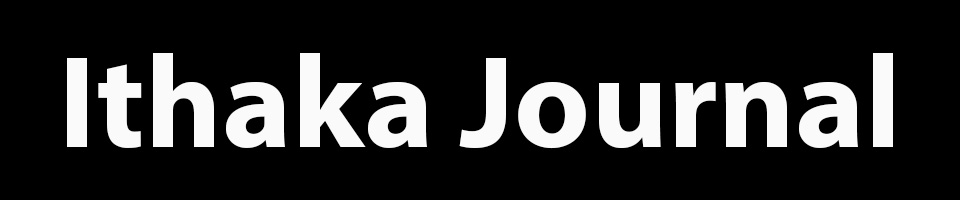
Michael Rosenthal
07.08.2010 21:00
Es ist schon erstaunlich, mit welch naiven Argumenten hier umgekehrt gearbeitet wird. Nichts gegen biologischen Anbau, aber Ihr betreibt hier eine gefährliche Verteufelung gegen den konventionellen Weinbau.
Hunderte von deutschen Winzern arbeiten sauber im Wingert und ebensoviele lassen spontan vergären. Es ist sogar ein deutlicher Trend festzustellen - zurück zur Spontanvergärung.
Viele Vinifizierungsmethoden (in Europa) halte ich auch für fragwürdig, unglaublich jedoch ist für mich noch immer die Tatsache, dass wir importierte Weine verkaufen dürfen, die nach industriellen Standards hergestellt werden, welche nach EU-Gesetzen nicht erlaubt sind !!!
Auf der anderen Seite kotzt mich aber auch immer wieder dieses "schöne neue Welt Gelaber" aus dem Biosektor an !
Mann oh Mann, Eure ungeschwefelten Weine konnte man bis vor kurzem nicht mal fürs Kochen nehmen !!!
Nichts für ungut, mir gefällt es wirklich sehr, was ich hier über Anbau, über Versuche und über Biodiversität lese und auch lerne, aber noch einmal, es kotzt mich an, wenn alle anderen Weinbauern, die nicht nach "Eurer Norm" arbeiten, quasi als Dilettanten dargestellt werden, als Helfer der Verblödung unkritischer Konsumenten.
SO IST ES NICHT !!!
Und nur mal vorbeugend weise ich darauf hin, dass ich kein Winzer bin, kein Önologe, aber trotzdem weiß, wie man z.B. sanft gegen Thrypse und Kräuselmilben vorgeht.
Es gibt haufenweise VdP Winzer und Bordeaux Winzer die zwar biologisch, oder sogar biodynamisch vinifizieren, dies jedoch nicht kommunizieren.
Dieser Artikel läuft ja quasi nach dem Motto
"Toller Wein - böser Winzer"
nur weil keine Eidechsen und Schmetterlinge im Wingert sind.
Was "Ihr" mit derartigen Artikeln betreibt, ist eine Art politischer Arbeit, die in meinen Augen nichts anderes ist, als "fishing for compliments" - wir sind toll, alle anderen sind böse.
Wenn es um die Haltung zu Wettbewerbern geht, mag ich persönlich doch eher das Motto:
Tue Gutes und halt die Fresse !
Alles andere klingt für mich immer unglaubwürdig...
hps
20.08.2010 17:10
Naturweine sind eine Sache der Leidenschaft und ebenso leidenschaftlich ist das Plädoyer unseres Autors, Claudio Niggli. Wir, am Delinat-Institut, lieben Naturweine, schon weil es uns als Wissenschaftler unheimlich interessiert und herausfordert, wie ein Wein sich ganz ohne jegliche Zusatzstoffe in der Zeit verhält. Eingestanden, wir sind da ein bisschen extrem und idealistisch und nicht 100% von wirtschaftlicher Vernunft. Denn das Risiko, das mit Naturweinen einhergeht, kann man mit einzelnen Fässern von 400 oder 228l eingehen, nicht aber mit Chargen von 10.000 l oder mehr. Es ist eine Nische, ist eine Passion, und wenn alles gelingt, entstehen Weine, wie Leonardo da Vinci sie trank, als er die Mona Lisa malte oder den Flugapparat erfand. Nichts lässt einen von solch einem Erlebnis wieder los. Noch dazu, wenn man für jeden Tag eine solche Flasche im Keller zu liegen hat. Es ist keine Kritik gegen Oenologen, deren Kenntnisse die Weine hervorbringen, die prestigieuse Wettbewerbe gewinnen. Und es ist auch keine Kritik gegen Biowinzer, die ohne Pestizide arbeiten und Weine produzieren, die denen der Oenologen in nichts nachstehen. Es ist eine Caprice, wie sie in einem Journal wie Ithaka ihren Platz finden soll. Ansonsten trinkt jeder den Wein, der ihm am besten entspricht.
Ob ein Wein ganz und gar natürlich ist, entscheidet sich letztendlich im Keller, die Frage der Biodiversität und nachhaltigen Traubenproduktion, die für Delinat so wichtig ist, ist eine ganz andere. Toller Wein - toller Winzer, das ist auch unser Maßstab, aber wir glauben eben, dass ersteres nur in Einklang mit der Natur und zweiteres nur dank der Natur erreicht wird.
Stefan Hemgesberg
21.02.2013 09:24
Hallo und sehr zum Wohle!
Diese und ähnliche Seiten schaue ich mir erst seit einiger Zeit an und finde es sehr interessant was da so alles geschrieben steht. Manches ist sehr mutig von solchen, die sich mit der Materie beschäftigen und durchaus auch einiges davon verstehen aber die Praxis nicht wirklich kennen. Wenn sie wüssten, wie schwierig die praktische Handhabung des konventionellen und auch natürlichen Weinanbaues und Bezeichnungsrechts ist - denn beide Erzeugungsmethoden M Ü S S E N sich am gleichen Weingesetz orientieren - dann würde mancher Artikel vielleicht etwas anders ausfallen. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht nur auf der einen Seite die Bösen und auf der anderen die Guten gibt.
Das möchte ich als erfahrener und herumgekommener Winzermeister mal so stehen lassen. Ich bin im elterlichen Weingut in diesen Beruf hineingewachsen, habe viele "Wein-Stationen" durchwandert, Höhen und Tiefen erlebt, kenne die Machenschaften der Weinindustrie, denen sich leider viele kleine Weinbaubetriebe anzupassen versuchen und kenne den traditionellen Weinbau in all seiner Vielfalt und Natürlichkeit. Meinen Beruf spüre ich als meine Berufung die mir Freude macht! Ich bin über 50 und weiss noch wie das ist, die Reben und den Wein mit den eigenen Händen, dem eigenen Gefühl und der Erfahrung vieler Winzergenerationen zu behandeln.
Dagegen machen das in der heutigen Praxis High-Tech-Maschinen oder die Hände von osteuropäischen Mitarbeitern oder sonstigen Billigarbeitskräften. Statt dem Gefühl für die eigenen Sinneswahrnehmungen haben derzeit Technik, Chemie und analytische Werte den Vorrang. Und statt der Erfahrung, die ich noch machen durfte, wird sich heute nach Lehrbüchern und medialen Meinungsmachern (die von denen gesponsert sind, die ihre Technik und Behandlungsmittel verkaufen wollen) an das die meisten Punkte bringende Geschmacksbild vorgearbeitet. Es ist halt die Art von Praxis, die den schnellen Euroumlauf mit sich bringt, auf den alle angewiesen sind. Hängen wir als Menschen nicht alle in der "Euro-Falle" und unseren kaputten Gesellschafts- und Konsumsystemen und deshalb kann ich auch dafür Verständnis haben.
Ich selber praktiziere seit etwa 10 Jahren einen Naturweinbau, der keinerlei Chemie anwendet. Weder Dünger, noch Spritzmittel, noch Weinbehandlungsmittel. Und ich sage mir heute als Ergebnis all meiner Erfahrungen: Unser/e Schöpfer/in kann doch nicht die Weinrebe erfunden haben, damit wir sie mit Chemie und Technik am Leben erhalten. Diese Art Weinbau bringt kleine aber feine Erträge in die Flaschen, die meine Kunden als das ansehen was sie sind - wertvoll!
Euch allen, die ihr das lest wünsche ich weiterhin viel Freude am Wein und der Beschäftigung damit. Das, was wir Menschen so oft und so gerne als gut und schlecht einstufen und beurteilen, das gibt es auch bei uns und bei allem, was der Mensch geschaffen hat und deshalb meine ich, hat alles seine Berechtigung. Und wenn es das sogenannte Schlechte nicht gäbe, dann würde das Gute/Besondere ja nicht mehr auffallen! Und sogar der alte Goethe sagte schon sinngemäß, "...dass sich der wahre Geschmack nur am allervorzüglichsten bildet."
Wohl denen, die es noch wahr-nehmen. In diesem Sinne arbeiten wir gerade an unserer neuen Internetseite und ich freue mich, wenn ich die/den ein oder anderen Leser/in auch mal persönlich kennenlerne - Ciao!