Erste HTC-Anlage in industriellem Maßstab
von Hans-Peter Schmidt
Bislang galt Biokohle vor allem als Hoffnung für eine nachhaltige Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bei gleichzeitiger Verminderung des CO2-Gehaltes der Luft. Bei der Herstellung von Biokohle wird beliebige Biomasse unter Luftabschluss und bei Temperaturen von 400 bis 900 ° C zu einem brennbaren Synthesegas und sehr reiner, hochporöser Kohle zersetzt. Neben der Pyrolyse, wie dieser Prozess genannt wird, gibt es aber auch andere technische Prozesse, bei denen Biomasse zersetzt und verkohlt wird. Eines dieser Verfahren ist das bereits 1913 von Friedrich Bergius erfundene Verfahren der Hydrothermalen Karbonisierung.
Hydrothermale Karbonisierung (HTC)
Das meist nach seiner englischen Abkürzung "HTC" benannte Verfahren der hydrothermalen Karbonisierung basiert darauf, dass Biomasse unter einem hohem Druck von über 20 bar für mehrere Stunden auf eine Temperatur von etwa 180° - 240° C erhitzt wird. Durch die Hitze und den Druck werden Hydroxidionen (OH-) und Wasserstoffionen (H+) aus den langkettigen organischen Molekülen der Biomasse herausgelöst. So entstehen neben Wasser (H2O) immer kohlenstoffreichere organische Polymere und Wärme, die bei diesem Prozess zusätzlich freigesetzt wird. Nach der Druckentspannung und Abkühlung des Kohle-Wassergemisches, wird die wässrige Lösung abgepresst, so dass Hydrokohle (HTC-Kohle) als Endprodukt entstehen. Die in der Biomasse ürsprünglich enthaltenen Mineralstoffe, Schwermetalle und eine Reihe nur teilweise zerstörte organische Verbindungen werden zum größten Teil mit der wässrigen Phase ausgepresst. Es gibt Bestrebungen, die Mineralstoffe aus der wässrigen Lösung als Düngemittel wiederzugewinnen, doch müssen hierfür noch einige technische Hürden überwunden werden.
Die Kohlenstoff-Effizienz des Prozesses ist sehr hoch, auch wenn sie nicht jene 100% erreicht, die manche ihrer Verfechter behaupten. Doch selbst bei einer C-Effizienz von 85 - 90 % erreicht das HTC-Verfahren die höchste Effizienz aller bekannten Umwandlungsmethoden für organische Abfälle wie z.B. Kompostierung, Vergärung, Pyrolyse usw.
Vergleich von Hydrokohle und Pyrokohle
Die Terminologie für die verschiedenen Prozesse und Kohleprodukte ist bisher nicht einheitlich (siehe auch den Artikel: Bio-Biokohle oder Nichtbio-Biokohle). Unter Bodenwissenschaftlern hat sich für HTC-Kohle der Begriff Hydrokohle und für die durch Pyrolyse hergestellte Kohle der Begriff Pyrokohle durchgesetzt. Als Biokohle gilt nur diejenige Pyrokohle, die auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Allerdings bezeichnen manche auch alle technisch aus Biomasse hergestellte Kohle als Biokohle.
Anders als bei der Pyrolyse wird beim HTC-Verfahren durch den hohen Druck die ursprüngliche Zellstruktur der Biomasse zerstört, so dass relativ homogene und weniger poröse Kohlen entstehen. Die Hydrokohlen besitzen durch ihre homogene, dichte Struktur sehr gute Brennwerte im Bereich von 25 MJ/kg (im Vergleich trockenes Holz: 19 MJ/kg; Rohbraunkohle: 9 MJ/kg; Holzkohle: 17 MJ/kg; Braunkohle: 21 MJ/kg). Dank geringen Transportvolumens, hoher Ascheschmelzpunkte und niedriger NOx-Emissionen sind Hydrokohlen hervorragend für die Wärme- und Energiegewinnung geeignet.
Da bei den relativ niedrigen Temperaturen des HTC-Prozesses nicht alle organischen Verbindungen aufbrechen, enthält das Endprodukt noch zahlreiche organische Verbindungen, die zwar bei der Verbrennung unproblematisch sind, die Hydrokohle aber nur bedingt als Düngemittel oder Bodenhilfsstoff einsetzen lässt. Versuche, bei denen Hydrokohle mit Biokohle und Kompost gemischt und gealtert wurde, lassen allerdings hoffen, dass auch Hydrokohle unter bestimmten Voraussetzungen zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit eingesetzt werden könnte.

Die bodenbiologogische Funktionsweise von Biokohle und Hydrokohle unterscheiden sich grundlegend. So sind bei Hydrokohle die für die Verwendung als Bodenhilfsstoff so bedeutenden Kriterien wie Wasserhaltefähigkeit, Nährstofffixierung (KAK), spezifische Oberfläche, Porendiversität deutlich niedriger als bei Biokohlen. Auch gibt es bisher noch keine verlässlichen Untersuchungen, wie lang Hydrokohle stabil im Boden verbleiben würde und insofern als Kohlenstoffsenke wirksam werden könnte.
Hydrokohle und Biokohle sind zwei grundlegend verschiedene Endprodukte der Biomasseumwandlung, die sich in einer umfassenden Biomassestrategie hervorragend ergänzen können.
Das
AVA-CO2-Verfahren
Im Unterschied zu zahlreichen anderen HTC-Entwicklungsprojekten, die trotz vollmundiger Ankündigungen und hohen Budgets bisher noch weit vom Dauerbetrieb industrieller Anlagen entfernt sind, hat sich AVA-CO2 früh auf das sogenannte Batch-Verfahren konzentriert. Hierbei wird aller zwei bis drei Stunden ein zentraler Reaktor vollautomatisch mit Biomasse befüllt. Bei einem Druck von 22 bar und Temperaturen um 220°C wird die Biomasse zersetzt, wobei nicht nur Kohle und Wasser, sondern auch Wärme erzeugt wird. Diese Wärme wird zur Aufrechterhaltung des Prozesses genutzt, so dass das Verfahren insgesamt nahezu energieautonom abläuft und künftig sogar einen Energieüberschuß produzieren könnte. Nach Beendigung des Verkohlungsprozesses wird das Kohle-Wassergemisch in einen Speichertank geschleust, so dass ein teil des hohen Drucks, unter dem das Kohle-Wassergemisch steht, zwischengespeichert bleibt. Sobald der Hauptreaktor erneut mit Biomasse befüllt ist, wird der Druck des Speichertanks genutzt, um den Druck im Hauptreaktor wieder aufzubauen. Auf diese Weise geht nicht nur sehr wenig Energie verloren, sondern es wird auch verhindert, dass die Umwelt durch Geruchs- und Klimagasse verunreinigt werden.

Das Batchverfahren ist so konzipiert, dass die Anlage ohne Eingriff von außen im 24-Stunden-Betrieb läuft. In der ersten industriellen Anlage in Karlsruhe wird derzeit nur ein Hauptreaktor mit einem Fassungsvermögen von 14 400 l und einem Jahresdurchsatz von 8400 t Biomasse eingesetzt. In nächsten Anlagen sollen jeweils 5 bis 10 solcher Hauptreaktoren parallel geschaltet werden, so dass ein Jahresdurchsatz von beeindruckenden 50.000 t Biomasse realistisch wird. In der Karlsruher Anlage wird derzeit Biertreber als zu verkohlende Biomasse benutzt, doch ließen sich auch nahezu alle anderen feuchten Biomassen wie Klärschlamm, Nahrungs- oder Vergärungsreste einsetzen.
AVA-CO2 ist eine schweizerische Firma mit Sitz in Zug, die hervorragende Ingenieurleistungen mit einem hoch professionellen Firmenkonzept vereint. Zahlreiche Kooperationen mit Forschungsinstituten, Wirtschaftsverbänden und Investoren lassen einen langfristigen Firmenerfolg erwarten. Man mag diesen Pionieren einer wahrhaft revolutionären Biomasse-Technologie viel Glück auf ihrem Entwicklungsweg wünschen und hoffen, dass sie sich trotz ihrer großen, eher zentral einsetzbaren Anlagentechnik dem Gedanken nachhaltiger Biomasseproduktion verschreiben und sich der Gefahren, die bei unbedachtem Einsatz drohen, stets bewusst bleiben.Weitere Informationen finden Sie unter: www.ava-co2.com
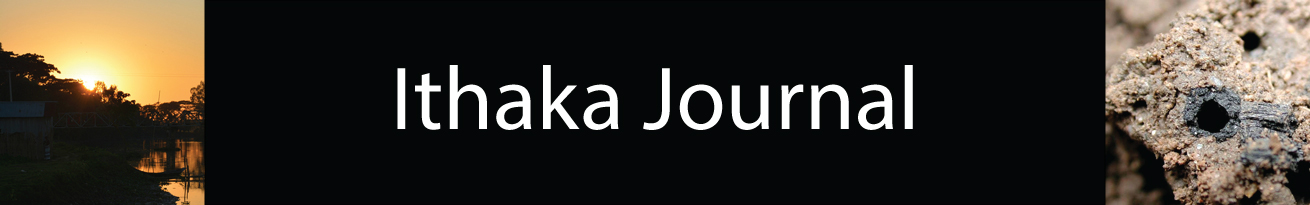
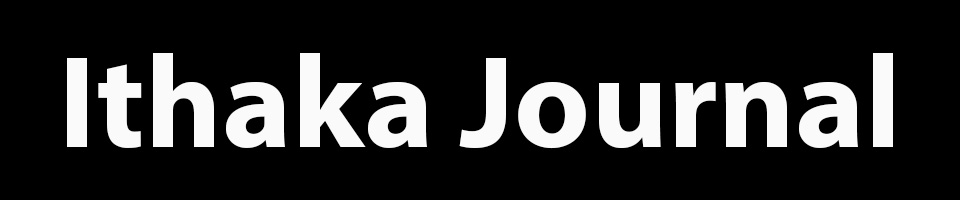
Jochen Binikowski
30.10.2010 20:49
Das sieht auf dem ersten Blick vielversprechend aus. Allerdings darf die Frage erlaubt sein, warum es keine Hinweise darauf gibt, was die Tonne Hydrokohle bei der geplanten größeren Anlage am Ende kosten wird.
Wenn die HTC-Kohle zur Verstromung eingesetzt werden soll, steht zu befürchten, dass hier das nächste bodenlose Subventionsfass aufgemacht wird. HTC würde dann in direkter Konkurrenz zu den Biogasanlagen stehen, und zwar sowohl bei der Stromeinspeisung als auch der Biomasse-Beschaffung. Der Gedanke, dass eine 500 KW Biogasanlage ca. 250 Hektar Maisfelder benötigt, lässt nichts Gutes in Bezug auf die Lebensmittelpreise erahnen.
James Elsener
31.10.2010 08:14
Interessant ist, dass Hydrokohle einen Heizwert von 25 MJ/kg aufweist. Damit ist es in der Region von Koks (23 - 31MJ/kg) und die Hydrokohle könnte Anwendung finden im Verhüttungsprozess zur Herstellung von Stahl.
Dies ist umso interessanter, da die Herstellung der Hydrokohle deutlich weniger Energie als die Herstellung von Koks zu benötigen scheint.
Hydrokohle kann aus jedem beliebigen Nassrückstand aus der Landwirtschaft oder auch aus Kläranlagen hergestellt werden und beeinflusst somit die CO²-Bilanz positiv.
Es bleibt zu hoffen, dass die Firma AVA-CO² nicht einfach im sozialdemokratisch fermentierten Subventionsdschungel ernten, sondern eine tatsächlich energierelevante Leistung erbringen will.
Walter Danner
31.10.2010 09:20
Der letzte Satz von Herrn Binikowski "Der Gedanke, dass eine 500 KW Biogasanlage ca. 250 Hektar Maisfelder benötigt, lässt nichts Gutes in Bezug auf die Lebensmittelpreise erahnen." hat mich veranlasst folgende Information auf diese Webseite zu stellen:
"Die verworfenen und weggeworfenen Lebensmittel Europas und Nordamerikas würden dreimal ausreichen, um alle Hungernden der Welt satt zu machen!"
Details unter http://www.sonnenseite.com/Aktuelle+News,Nicht+gleich+wegwerfen!+Frisch+auf+den+Muell+muss+nicht+sein,6,a17373.html
Damit ist klar, dass wir noch großen Spielraum haben, um statt Lebenmittel Energie auf den Äckern zu erzeugen.
Wir sollten in Deutschland auch mal darüber nachdenken den Fleischkonsum auf das Niveau der Italiener zu senken. Dann würden wieder Flächen für die Energieproduktion frei statt für die energieverschwendende Fleischproduktion.
Die Lebensqualität der Deutschen würde damit wahrscheinlich noch steigen.
"Hohe" Lebensmittelpreise: Der Deutsche verwendet nur noch 11% seines Einkommens für Lebensmittel!
Meine Schlussfolgerung: Keine Angst vor steigenden Lebensmittelpreisen wegen der Produktion von Energie aus Biomasse.
Jochen Binikowski
31.10.2010 10:59
Als es damals mit dem Biogas und Biosprit losging, hieß es auch, dass die Lebensmittelpreise davon nicht berührt werden. Tatsächlich sind dann aber massenhaft Tropenwälder abgeholzt worden und in Deutschland sind die Pachtpreise für Maisland rapide gestiegen. Das war auch einer der Gründe für die Preisexplosion 2008 und den daraus resultierenden Hungerrevolten.
Natürlich gibt es sinnvolle Methoden, z.B. die Verwertung von Abfällen. Auch gibt es ein unglaubliches Steigerungspotenzial bei den Ernteerträgen in der Dritten Welt. Nur, letztendlich wird leider immer das gemacht was kurzfristig den höchsten Profit verspricht. Genau diese Gefahr sehe ich bei der HTC Technik. Da wird man sich auf diejenige Biomasse konzentrieren, von der die höchste Ausbeute zu erwarten ist.
hps
31.10.2010 16:46
Ich schätze die Gefahr, die Herr Binikowski beschreibt, ebenfalls als sehr real ein. Die Einschränkungen für die einzusetzenden Biomassen, wie wir sie in den Richtlinien für Biokohle fordern, werden von derart großen Anlagen kaum eingehalten. Und eine Selbstbeschränkung der Industrie, die von ihren Kunden den Einsatz nachhaltig erzeugter Biomassen verlangen, ist sicher ebenfalls nicht realistisch. Hier noch mal unser Richtlinienvorschlag, dessen Einhaltung den schlimmsten Mißbrauch verhindern würden:
A. Eingesetzte Biomasse
1. Reine Organische Reststoffe ohne relevant toxische Belastungen durch Schwermetalle, Farbreste, Lösungsmittel etc. Saubere Trennung von nichtorganischen Abfällen wie Elektronikschrott, Plaste, Gummi etc. [In einem Anhang sollte eine Positivliste mit verwendbaren Biomassen geführt werden: Grünschnitt, Borke, Sägespäne, Gärreste, organische Hausabfälle, Fäkalien, Mist, Lebensmittelreste, Schlachtabfälle …]
2. Land- und forstwirtschaftliche Reststoffe wie Getreidespelz, Fruchtschalen, Fruchtkerne, Trester, Borke etc. (Positivliste)
3. Landwirtschaftliche Produkte aus dem Anbau von Energiepflanzen, die ohne Pestizide, Herbizide, Mineraldünger und genetisch modifiziertes Saatgut erzeugt sind und maximal 15% der landwirtschaftlichen Nutzfläche einer Region entsprechen. [Ackerforstwirtschaft, Energiepflanzen – die Begrenzung auf 15% soll die Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion einschränken, die Höhe des Prozentsatzes wäre zu diskutieren]
4. Biokohle darf nur dann aus Forstholz gewonnen werden, wenn eine nachhaltige Bewirtschaftung des entsprechenden Waldes gewährleistet ist. Insbesondere die Abholzung von Regenwald, wie es derzeit zur Produktion von Holzkohle weitflächig der Fall ist, muss verhindert werden.
hps
23.01.2011 12:36
Am Frühjahr 2011 werden am Standort von Swiss biochar wieder regelmäßige Publikumsführungen organisiert. Bei dieser Gelegenheit können dann auch jeweils 10 kg Biokohle für den Kleingartenversuch erworben werden.
David Tauch
09.02.2014 11:02
mittel und langfristig kann allein HTC,
unabhangigkeit Fossiler Kohlewasserstoffe bewirken.
- Fracking verseucht Grundwasser, Treibhauseffekt nicht gelöst.
- flüssige KW werden weiterhin Hauptenergietrager ungebunder Transportmittel bleiben.
- Terror finanziert durch die Öl kaufe des Westens in Nahost wird teurer als HTC.
- Mit Atomenergie können wir nicht sicher umgehen.
HTC ist eine FRIEDENSTECHNOLOGIE.